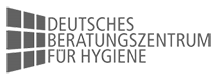Ursachen und Behandlung funktioneller Störungen

Körperliche Beschwerden ohne Befund – was bedeutet das?
Definition funktioneller Störungen
Funktionelle Störungen beschreiben körperliche Beschwerden, für die sich trotz gründlicher medizinischer Untersuchungen keine organische Ursache finden lässt. Das bedeutet nicht, dass die Symptome eingebildet sind – im Gegenteil: Sie sind real, beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich und können chronisch werden. Typische Merkmale funktioneller Störungen sind:
- Fehlender medizinischer Befund: Ärztliche Untersuchungen zeigen keine organische Ursache für die Beschwerden.
- Dauerhafte Symptome: Die Beschwerden bestehen über einen längeren Zeitraum hinweg und treten immer wieder auf.
- Starke Beeinträchtigung: Betroffene fühlen sich im Alltag, im Beruf und im sozialen Leben eingeschränkt.
- Individuelle Ausprägung: Die Art und Intensität der Beschwerden variiert stark von Person zu Person.
Damit wird deutlich: Funktionelle Störungen sind keineswegs ein Randphänomen, sondern betreffen viele Patient*innen, die sich ernsthafte Sorgen machen und nach Erklärungen suchen.
Abgrenzung zu organischen Erkrankungen
Ein wichtiger Schritt im Verständnis funktioneller Störungen ist die Abgrenzung zu klar diagnostizierbaren organischen Erkrankungen. Während sich bei letzteren mithilfe von Laborwerten, bildgebenden Verfahren oder anderen Tests eindeutige Ursachen feststellen lassen, bleibt bei funktionellen Störungen ein „medizinisches Rätsel“ bestehen.
Für Betroffene kann das besonders belastend sein: Die Beschwerden sind spürbar, doch der fehlende Befund führt nicht selten zu Verunsicherung – sowohl bei den Patient*innen selbst als auch in ihrem Umfeld.
Häufige Symptome und chronische Beschwerden
Körperliche Anzeichen ohne organischen Befund
Funktionelle Störungen äußern sich in einer Vielzahl körperlicher Symptome, die trotz intensiver medizinischer Diagnostik nicht auf eine klare organische Ursache zurückzuführen sind. Für Betroffene sind die Beschwerden jedoch real und mitunter stark einschränkend. Typische Anzeichen sind:
- Magen-Darm-Beschwerden: Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder ein dauerhaftes Völlegefühl, die trotz unauffälliger Befunde immer wieder auftreten.
- Herz-Kreislauf-Symptome: Herzrasen, Schwindel oder Brustschmerzen, die oftmals mit Angst vor einer schweren Erkrankung verbunden sind, obwohl das Herz gesund ist.
- Chronische Schmerzen: Anhaltende Kopf-, Rücken- oder Gelenkschmerzen, die sich nicht durch bildgebende Verfahren oder Laborwerte erklären lassen.
- Ermüdung und Schwäche: Ein ständiges Gefühl von Erschöpfung, das selbst durch ausreichend Schlaf und Ruhe nicht verschwindet.
Studien belegen, dass solche Beschwerden keineswegs selten sind: In einer bevölkerungsbasierten Untersuchung gaben rund 30 % der Frauen und 25 % der Männer in Deutschland an, regelmäßig unter Erschöpfung, Rückenschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden zu leiden – ohne dass eine organische Ursache gefunden werden konnte (Beutel et al., 2020)

Chronische Beschwerden und ihr Einfluss auf den Alltag
Funktionelle Störungen wirken sich häufig auch auf die Psyche aus. Viele Patient*innen erleben zusätzlich:
- Angstgefühle: Die Sorge, dass sich doch eine ernste Krankheit hinter den Beschwerden verbirgt. Diese Ängste können alltägliche Entscheidungen belasten und zu einer ständigen Selbstbeobachtung führen.
- Depressive Verstimmungen: Die dauerhafte Belastung führt nicht selten zu Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und einem Gefühl der Hilflosigkeit.
- Verlust von Lebensqualität: Betroffene fühlen sich in ihrem Alltag stark eingeschränkt, was wiederum den Leidensdruck verstärkt.
Diese psychischen Folgen sind keine Nebensache, sondern verstärken den Teufelskreis aus Beschwerden und Belastung erheblich.
Ursachen und Risikofaktoren
Psychische Belastungen und Stress
Ein wesentlicher Faktor bei funktionellen Störungen sind psychische Belastungen. Dauerhafter Stress am Arbeitsplatz, familiäre Konflikte oder traumatische Erlebnisse können sich in Form körperlicher Symptome äußern. Viele Patient*innen berichten, dass die Beschwerden in besonders angespannten Lebensphasen zunehmen und mit Entlastung wieder etwas abklingen. Damit zeigt sich deutlich, wie eng Körper und Psyche miteinander verbunden sind.
Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche
Funktionelle Störungen entstehen oft im Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die Psyche beeinflusst den Körper – und umgekehrt. So können:
- Körperliche Signale verstärkt wahrgenommen werden, wenn Betroffene bereits verunsichert sind.
- Psychischer Druck wie Leistungsanforderungen oder Sorgen das Nervensystem in ständige Alarmbereitschaft versetzen.
- Fehlende Erholung den Körper daran hindern, Stressreaktionen abzubauen.
Diese Wechselwirkung erklärt, warum Beschwerden ohne organischen Befund so belastend sein können: Sie sind real, auch wenn sich keine eindeutige körperliche Ursache finden lässt.

Familiäre und soziale Faktoren
Neben Stress spielen auch familiäre und soziale Einflüsse eine Rolle. Menschen, die in einem Umfeld mit hohen Erwartungen, Konflikten oder mangelnder Unterstützung leben, sind anfälliger für funktionelle Störungen. Auch gesellschaftlicher Druck – etwa ständige Erreichbarkeit oder der Anspruch, immer leistungsfähig sein zu müssen – kann das Risiko erhöhen.
Persönliche Bewältigungsstrategien
Wie Menschen mit Belastungen umgehen, wirkt sich ebenfalls auf die Entstehung funktioneller Störungen aus. Typische Muster sind:
- Perfektionismus: Der Drang, immer fehlerfrei sein zu müssen, erhöht den inneren Druck.
- Unterdrückte Emotionen: Gefühle wie Trauer oder Wut werden nicht ausgedrückt, sondern schlagen sich in körperlichen Beschwerden nieder.
- Vermeidung: Anstatt Probleme aktiv anzugehen, ziehen sich Betroffene zurück – was kurzfristig entlastet, langfristig aber die Symptome verstärken kann.
Solche Strategien entstehen oft unbewusst, können aber maßgeblich dazu beitragen, dass funktionelle Störungen chronisch werden.
Diagnose bei funktionellen Störungen
Schwierigkeit der Abklärung ohne Befund
Die Diagnose funktioneller Störungen stellt Ärzt*innen und Patient*innen gleichermaßen vor Herausforderungen. Zunächst müssen körperliche Ursachen gründlich ausgeschlossen werden – oft durch Bluttests, bildgebende Verfahren oder fachärztliche Untersuchungen. Wenn dabei kein eindeutiger Befund vorliegt, fühlen sich viele Betroffene unverstanden oder nicht ernst genommen.
Dieser Prozess ist für Patient*innen häufig frustrierend, da die Beschwerden real und belastend sind, auch wenn sich keine klare organische Ursache nachweisen lässt. Wichtig ist deshalb eine sensible Kommunikation, die deutlich macht: „Ihre Beschwerden sind ernst zu nehmen – auch ohne sichtbaren Befund.“
Rolle der psychosomatischen Medizin
Die psychosomatische Medizin nimmt bei der Diagnose eine Schlüsselrolle ein. Sie berücksichtigt den Zusammenhang zwischen Körper und Psyche und ermöglicht so eine umfassendere Betrachtung. Typische Elemente der Diagnostik sind:
- Anamnese-Gespräch: Eine ausführliche Erhebung der Lebensgeschichte, aktueller Belastungen und Beschwerden.
- Psychologische Diagnostik: Tests und Gespräche helfen, psychische Faktoren wie Stress, Depressionen oder Ängste zu erfassen.
- Ganzheitliche Betrachtung: Körperliche, psychische und soziale Aspekte werden in Beziehung zueinander gesetzt, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Auf diese Weise entsteht ein Ansatz, der über reine Ausschlussdiagnostik hinausgeht und Betroffenen hilft, ihre Beschwerden besser zu verstehen.
Lesen Sie, welche Hürden häufig bestehen und wie sie überwunden werden können.
Behandlungsmethoden in der Klinik Friedenweiler
Die Klinik Friedenweiler verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um Patient*innen mit funktionellen Störungen individuell zu unterstützen. Dabei kommen unterschiedliche Therapien zum Einsatz, die Körper und Psyche gleichermaßen berücksichtigen:
- Psychotherapie – individuelle und gruppentherapeutische Gespräche zur Bearbeitung von Stress, Ängsten und inneren Konflikten.
- Verhaltenstherapie & schematherapeutische Ansätze – Unterstützung beim Erkennen und Verändern ungesunder Muster, die funktionelle Beschwerden verstärken.
- Achtsamkeitsbasierte Verfahren – Techniken zur besseren Körperwahrnehmung und Stressreduktion.
- Körper- und Bewegungstherapie – Förderung eines gesunden Körpergefühls und Abbau von Spannungen.
- Kreativ- und Kunsttherapie – nonverbale Ausdrucksformen, um innere Belastungen sichtbar und bearbeitbar zu machen.
- Musik- und Stimmtherapie – emotionale Entlastung und Förderung des seelischen Gleichgewichts.
- Natur- und tiergestützte Therapien – heilende Wirkung von Naturerlebnissen und Tieren im Genesungsprozess.
- Entspannungsverfahren – Methoden wie progressive Muskelentspannung, Atemübungen oder Meditation.
FAQ
Können funktionelle Störungen von selbst wieder verschwinden?
Ja, in manchen Fällen klingen funktionelle Beschwerden nach einer gewissen Zeit von selbst ab, vor allem wenn Stressfaktoren nachlassen oder sich Lebensumstände verändern. Dennoch ist es ratsam, die Symptome ernst zu nehmen und professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen. So können Rückfälle vermieden und langfristige Strategien für einen gesunden Umgang mit Belastungen entwickelt werden.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei funktionellen Beschwerden?
Studien zeigen, dass Frauen häufiger über funktionelle Beschwerden berichten als Männer. Das bedeutet jedoch nicht, dass Männer weniger betroffen sind – sie sprechen die Symptome oft seltener an oder suchen später Hilfe. Geschlechtsspezifische Unterschiede können auch in der Wahrnehmung und im Umgang mit den Beschwerden liegen, weshalb eine individuelle Herangehensweise besonders wichtig ist.
Welche Rolle spielen Bewegung und Ernährung bei funktionellen Störungen?
Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung können die Beschwerden positiv beeinflussen. Körperliche Aktivität wirkt sich nicht nur auf den Kreislauf und die Muskulatur aus, sondern auch auf die Psyche, da Stresshormone abgebaut werden. Eine bewusste Ernährung unterstützt den Körper zusätzlich bei der Regeneration. Beide Faktoren sind daher wertvolle Bausteine, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern und funktionelle Störungen zu lindern.
Leiden Sie an seelisch-körperlichen Schmerzen?
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne, die Klinik Friedenweiler hilft Ihnen weiter!

Burnout und Erschöpfungssyndrome
Burnout ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom, das unbehandelt in psychosomatischen...

Verhaltenstherapie
Die Verhaltenstherapie behandelt gezielt die Symptome psychischer Erkrankungen und soll die Handlungsfähigkeit...

Burnout - Wie können Angehörige helfen?
Angehörige stehen der neuen Situation zunächst oft rat- und hilflos gegenüber, jedoch gibt es Möglichkeiten, wie sie die Betroffenen unterstützen können...